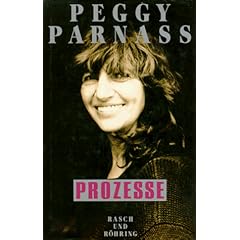"
Man muss sich nicht entschuldigen, weil man seine Seele besitzen will" schreibt Erica Jong in
Angst vorm Fliegen, dem feministischen Klassiker aus den 70ern, eine weibliche Maxime, die auch in Maria Sevelands
Bitterfotze noch 2009 kein Stück ihrer erhabenen Würde und der darin liegenden
Zerbrechlichkeit eingebüßt hat.
Auf der Rückfahrt von Hamburg habe ich begonnen,
Bitterfotze zu lesen, während am Fenster windige Landschaften und graue
Vorstadtbahnhöfe unter einem bedeckten Himmel mit hoher Geschwindigkeit an mir vorbeiziehen , der Mann hat neben mir die Beine übereinandergeschlagen, sein Knie liegt auf meinem Oberschenkel.
Sara, die Protagonistin, entflieht dem dunklen Stockholm im Januar für eine Woche um allein nach Teneriffa zu fliegen. Allein - obwohl sie einen zweijährigen Sohn und einen Mann zu Hause hat. Diese Tatsache bringt mich nicht ins Grübeln, wohl aber ihr Umfeld, alle reisen mindestens zu zweit,
Pärchen und Kleinfamilien so weit ihr Auge reicht, im Flieger, im Bus zum Hotel, im Frühstücksraum. Eine Frau allein in dieser urlaubsbedingten Harmoniehölle ist ein Novum, und wie sie nur ihr Kind allein lassen kann, dieser zügellose Egoismus. Das Buch spielt, wie gesagt, 2009, die Autorin lebt in Schweden, einem als politisch fortschrittlich empfundenen Land (man sehe sich nur die hervorragenden Pisa-Ergebnisse an) und findet offenbar, dass sie auch hier und heute als Frau noch unzählige Gründe hat, bitterfotzig zu sein - obwohl sie das gar nicht will, nie wollte. Das Buch führt mir wie eine
Ohrfeige vor Augen wie schwer es noch immer ist, in Europa und erst recht sonstwo auf der Welt, nach einer Schwangerschaft nicht zum Muttertier zu mutieren, stark zu sein, berufstätig zu sein, unabhängig zu leben.

Maria Sveland hat ihrem Buch diesen unglaublich destruktiven Titel gegeben, damit es kein anderer tut, ich kann nur sagen: gut gemacht. Keine Frau will bitterfotzig sein, aber es will auch keine Gründe dafür haben. Die Autorin hat mit der Wahl dieses Buchtitels KritikerInnen der Möglichkeit beraubt, sie selbst als Bitterfotze abzustempeln und gleichzeitig die Chance wunderbar genutzt um zu zeigen, wie viele Hoffnungen, Träume, Freiheit und Lebensklugheit in einer Feministin stecken können. Unsere Zeit zerrinnt für Frauen zwischen Emanzipation, vielgepriesener und manchmal gelebter
Unabhängigkeit, auf der anderen Seite die schwer verdaulichen Fakten, Webseiten, Verhaltensweisen, gesellschaftlichen Normen und Zwängen, welche Kehrseiten erahnen lassen. Vor kurzem
interviewte die
Zeit Online den Soziologen Carsten Wippermann zu seiner Studie über Frauen in Führungspositionen. Die Ergebnisse führen einem unweigerlich vor Augen, dass es sich bei der
Gläsernen Decke nicht um einen hohlen Kampfbegriff, sondern um gelebte Berufsrealität handelt. Aus verschiedensten Motiven bleibt der Weg für Frauen in die Machtetagen von Konzernen hart und oftmals gänzlich versperrt (mehr dazu
hier) - eines von vielen Hindernissen, die eine Frau noch heute überwinden muss, sofern sie die Kraft und den Willen dazu hat.
Im Buch begegnet Sara, mit ihrem Sohn im Park unterwegs, einem Vater mit Kinderwagen und einem Shirt mit der Aufschrift
Vaterurlaub. Er hat es von der Krankenkasse geschenkt bekommen und Sara fragt sich, warum Männer T-Shirts kriegen für das, was für die Mütter eine Selbstverständlichkeit ist, die zum Himmel stinkt. Ich schaue auf und sehe das Profil des Mannes, der ohne T-Shirt Kinderwägen schieben wird.
Sara hat früh begonnen, sich mit Feminismus zu beschäftigen, hatte Spaß daran, als Studentin zügellos Männer aufzureißen, ohne
Anklang zu erwarten, wohlwissend, welche Provokation eine erobernde Frau darstellen kann. Sie entscheidet sich für den, der nicht wegläuft, als sie ihn fragt, ob er "einen harten pochenden" habe, der sich stattdessen mit ihr im Bett verkriecht, so lange bis absolut nichts mehr zu Essen im Haus ist. Derselbe Mann, der sie Jahre später nach der Geburt wochenlang mit dem Kind allein lässt, weil er arbeiten muss. Weil er einen Vertrag unterschrieben hat, lange vorher.
Und heiraten. Sara heiratet und freut sich und ist verliebt und fühlt sich fremd dabei. Es ist die Sehnsucht nach Nähe, nach einem Menschen der beständig an ihrer Seite ist, vielleicht auch nach kleinen jungen Kinderleben, in deren Adern das eigene Blut fließt.
Bitterfotze hat ein
heteronormatives Ende. Während Isadoras Eheschicksal in
Angst vorm Fliegen offen bleibt, stellt Sara am letzten Urlaubstag fest, dass sie schwanger ist und fliegt zurück nach Hause mit dem Willen weiterzukämpfen für Unabhängigkeit und Liebe, Geborgenheit und Freiheit, alles gleichzeitig,
maximales Glück, fast unerreichbar - aber nur fast.
Ich lese und frage mich, in ein paar Tagen noch immer
zarte 20 Jahre alt, wie ich stets so überzeugt, so unzerrüttet glauben konnte, dass alles, das maximale Glück, einfach so eintreten, für mich funktionieren würde. Im Hinterkopf zu behalten, dass es möglicherweise nicht leicht gelingen kann, eines Tages eine
freie Mutter zu sein, ist etwas anderes, als diese Ohrfeige auf einem
grellpinken Tablett serviert zu bekommen. Einhalten und nachdenken, mit 20, bevor die Dinge entgleiten und ich mich womöglich frustriert und abhängig, in 24 Stunden eines Tages gebunden wiederfinde. Und ich stelle fest, dass ich trotzdem alles will, mehr denn je und ohne mich jemals dafür entschuldigen zu müssen, dass ich meine Seele besitzen will. Und einmal mehr bin ich mir bewusst, wie gut sie tun, all die Männer, die mit uns auf Augenhöhe leben, zusammenarbeiten und klar denken.
Der Feminismus lebt mit ihnen und kann nicht ohne sie, um an das Ziel einer Gleichberechtigung zu gelangen, die ihren Titel verdient, unerreichbar ohne beiderseitige Akzeptanz und Respekt und nicht zuletzt Liebe, platonisch oder sexuell oder beides gleichzeitig, Augenhöhe als Maßstab.

Wir sind jung und wollen viel, Bildung und Beruf und die Feinheiten des Lebens in vollen Zügen genießen, Zeit um ungestört Gedanken nachzuhängen, Bücher zu lesen, flach auf dem Boden liegen und Musik hören, zur selben Zeit geborgen sein, einen Menschen bei uns haben, dessen Hand wir halten können wann immer wir wollen,
gemeinsame Stunden, Tage, Wochen verbringen, die Welt sehen und zurückkehren und allein sein mit einer
Tasse Tee. Der Spagat zwischen Freiheit und Geborgenheit scheint schwer, beinahe unerreicht und doch möglich, wenn man sich früh genug und schonungslos darüber klar wird, was es bedeutet, ich zu sein. Mit allen Träumen und Wünschen, Wahr- und Eigenheiten.
 Alltag in der Uni, ich pendele zwischen den wichtigsten Vorlesungen und dem heimischen Schreibtisch hin und her, Klausurtermine rücken näher ohne maßgeblichen Erkenntnisgewinn in der verstreichenden Zeit. Abgehetzte gemeinsame Mittagspausen, Gespräche, die eine Zigarette dauern, manchmal auch nur zwei Schlucke meines Takeaway-Cappuccinos. Ich sehe mein virtuelles Kind leiden, mich vermissen, zu viele Dinge, die ich betexten und in Worte kleiden will, einen Moment lang stehenbleibend zwischen Bücherregalen in der Bibliothek. Bald zurück.
Alltag in der Uni, ich pendele zwischen den wichtigsten Vorlesungen und dem heimischen Schreibtisch hin und her, Klausurtermine rücken näher ohne maßgeblichen Erkenntnisgewinn in der verstreichenden Zeit. Abgehetzte gemeinsame Mittagspausen, Gespräche, die eine Zigarette dauern, manchmal auch nur zwei Schlucke meines Takeaway-Cappuccinos. Ich sehe mein virtuelles Kind leiden, mich vermissen, zu viele Dinge, die ich betexten und in Worte kleiden will, einen Moment lang stehenbleibend zwischen Bücherregalen in der Bibliothek. Bald zurück.