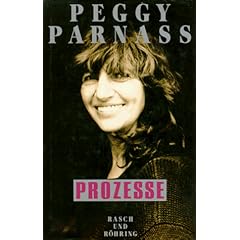es ist
Freitag. Eine weitere Woche mit dem üblichen Pensum an Informationskonsum im Internet ist eben dabei, an mir vorbeizuziehen. Einige Dinge sind hängengeblieben, widerstreitende Debatten in meinem Kopf neben
personal entertainment. Man liest viel in letzter Zeit, in den vergangenen Wochen und Monaten, bald Jahren, über das
Massensterben von Tageszeitungen, wegbrechende Anzeigenkunden und die Suche der Schuldigen im Internet - ich trage maßgeblich dazu bei.
Dass es auch anders gehen kann zeigt
dieser Artikel bei
dasmagazin.ch: Tageszeitungen sind keineswegs
todgeweiht, sie müssen sich nur dem veränderten Konsumverhalten ihrer informationsgierigen Käufer anpassen. Der Text nennt drei Beispiele aus Holland, Schweden und Portugal, die zeigen, dass man sich mit ein paar wichtigen Neuerungen durchaus den maßgeblich durch das Internet veränderten Begebenheiten anpassen kann: Grundvoraussetzung ist zunächst, dass man von der
Informiertheit des Käufers ausgeht, die er ja bereits im Internet erworben hat, um darauf aufbauend die wichtigsten Meinungen zum jeweiligen Thema zu liefern. Die These lautet, dass das Netz die gewünschten Informationen zwar in ihrer gesamten Breite und zudem am schnellsten liefert, die Tageszeitungen diese jedoch nach Verlässlichkeit und Relevanz zu filtern in der Lage sind. Und relevante Informationen mit möglichst hohem Wahrheitsgehalt, das wollen wir ja alle.

Ein weiteres Problem der Tageszeitung und deren Online-Auftritten: Man hätte gern, dass User die Tageszeitung auch im Netz von vorne nach hinten "durchblättern" - man hält also auch online weitgehend an der Gliederung in
Ressorts fest.
Mario Sixtus erklärt hierzu in einem anschaulichen
Clip zur
Zukunft des Journalismus beim
elektrischen Reporter, dass ebendies nicht der Fall ist. Vielmehr gelangen viele über Seiteneingänge zum gewünschten Artikel: Verlinkungen von überallher aus den Tiefen des web 2.0. Wie aber können die Zeitungen, deren Werbeeinnahmen im Internet nicht annähernd mit denen von einst vergleichbar sind, in Zukunft noch ihrer für die Demokratie
zentralen Aufgabe, der kritischen Reflexion des politischen Geschehens für die breite Masse, noch nachkommen? Auch hierzu werden im Video ein paar grundsätzliche Fragen aufgeworfen, deren Beantwortung erst recht nicht aus dem Stehgreif erfolgen kann.
Wer aber soll das eigentlich sein, der oder die durchschnittliche InformationskonsumentIn im Internet? Noch gibt es keine verlässlichen
Zahlen über die Anzahl der Twitter-NutzerInnen in Deutschland, die Angaben schwanken zwischen fünfzig- und hundertzwanzigtausend. Zieht man diejenigen ab, die Twitter lediglich als
Werbeinstrument benutzen, so bleibt nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung übrig - der schätzungsweise überwiegend aus TeilnehmerInnen mit publizistischen Interessen besteht (für den Freundes- und Bekanntenkreis bestimmte Veröffentlichungen mal ausgenommen). Meine Generation, die eigentlich weitestgehend mit dem Internet aufgewachsen sein sollte, nutzt dieses zunächst lediglich als
Kommunikationsmedium. Twitter als hauptsächlichen Indikator für die Bereitschaft zu einer breiteren Webnutzung zu missbrauchen wäre sicherlich vermessen, aber es bietet sich hier zumindest ein Anhaltspunkt.
Meine KommilitonInnen posten
Urlaubsfotos auf Facebook, hören Musik bei Youtube und checken ihre Mails, ein mittlerweile alltäglicher Betrieb im social web - dabei bleiben die viel weiter reichenden Kapazitäten des Internets größtenteils ungenutzt. Das Netz als Arbeitsplatz, Markt für Informationen jeglichen Genres sowie zum Echtzeit-Austausch im
Mikroblogformat ist auch unter StudentInnen noch lange nicht mehrheitsfähig. Vielen genügt allein die
Möglichkeit, eine Zeitung ebensogut online lesen zu können, ob dies in vergleichbarem Maße praktiziert wird, steht auf einem anderen Blatt.
Für mich ist das Internet schon lange Teil meiner realen Welt, an der wiederum das Netz via Twitter, Blog und Facebook teilhat. Mein Blog ist das geliebte virtuelle
Kind, an dem ich selbst wachse, mein Projekt, das Energie und Zeit und Liebe für sich beansprucht.
Meine Woche im Netz hat ein paar feine Informationshappen für mich bereitgehalten. Mit einer Zusammenfassung meiner
Link-Top-5 verabschiede ich mich ins Wochenende. Ich werde
20. Zeit für ein bisschen Offline-Feiern.
+
Hilfe, die Prinzessinnen kommen - die
Mädchenmannschaft über geschlechtsspezifische Schulbücher
+
Armer Mann, was nun? - die
Zeit Online über Hetero-Beziehungen, in denen die Frau mehr verdient (ja, Abhängigkeit macht unglücklich - Frauen und Männer offensichtlich auch)
+
Justitias Augenbinde verrutscht - Rechtsphilosoph Bertram Keller beim
Freitag über Anonymität und Selbstbestimmung
+ ART. Entdeckung der Woche:
herakut+ nicht zuletzt: die Meldung des Tages.
Barack Obama erhält den Friedensnobelpreis. Einen unter vielen lesenswerten Kommentaren dazu gibt's bei
Spiegel Online
 Die Kitschigkeit des Moments, in dem sich die Vormittagssonne in den gläsernen Weihnachtsbaumkugeln bricht, wird mit der dritten Tasse Kaffee nur beinahe weggespült. Thank God, thanks to who ever, it's monday, ein Stückchen Alltag in angetrockneter Bratensoße.
Die Kitschigkeit des Moments, in dem sich die Vormittagssonne in den gläsernen Weihnachtsbaumkugeln bricht, wird mit der dritten Tasse Kaffee nur beinahe weggespült. Thank God, thanks to who ever, it's monday, ein Stückchen Alltag in angetrockneter Bratensoße.